|
|
|
schließen |
||
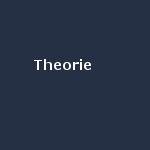
|
Das Schöne in der Architektur – Die Idee des Schönen und seine Bedeutung für den architektonischen Raum.
 Als Alltagsbegriff bezeichnet das Schöne umgangssprachlich ein subjektives Geschmacksurteil, abhängig von Mode und Zeitgeist. Für die Ästhetik und Kunstrezeption der Gegenwart ist der Begriff entwertet. Dennoch benutzen wir ihn in einer selbstverständlichen Weise. Die Untersuchung zeigt, daß der Begriff des Schönen für eine Rezeption des architektonischen Raumes eine übergeordnete und sinnvolle Bedeutung besitzen kann.  Die mittelalterliche Vorstellung des Schönen liegt im Begriff der Anschauung als mystische Erfahrung begründet. Diese intelligible Schönheit bildet die Grundlage einer transzendentalen Erfahrung. Das farbige Licht in den Kirchenräumen nimmt das göttliche Leuchten vorweg.  Gottlieb Alexander Baumgarten emanzipierte den Begriff des Schönen von seiner Abhängigkeit zu geometrisch logischen, geistigen Systemen, wie er in der abendländisch-griechischen Tradition grundgelegt wurde. Er arbeitete den sinnlichen Wahrnehmungscharakter des Schönen heraus.  Immanuel Kant schließlich begründete unser heutiges Verständnis des Schönen, indem er es als der „Kritik der Urteilskraft“ unterworfen ethisch definierte. Aber auch Kant war sich in seinen Ausführungen zum Begriff des Erhabenen bewußt, daß geistige Erkenntnis und sinnliche Ansprache nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können.  Mit dem Verlust eines verbindlichen Wertesystems verstärkte sich der subjektive Charakter des Begriffs und wurde schließlich im 20. Jahrhundert den ökonomischen Interessen des Marktes und der Werbung unterworfen.  Mit der Entwicklung einer phänomenologischen Betrachtungsweise ergab sich die Chance einer neuen Interpretation des Schönen. Das Potenzial einer sinnlichen Wahrnehmung ist hierbei grundlegend. Merleau-Ponti betonte später die Bedeutung des Leibes als Instrument eigener sinnlicher Erkenntnis. Aus der Erkenntnisfähigkeit der Sinne kann eine eigene Begiffsbestimmung des Schönen abgeleitet werden. Am Beispiel der Farbe, deren sinnlich sittliche Wirkung schon J.W. Goethe zur Grundlage seiner Farbenlehre genommen hat, wird der Begrifff des Schönen neu bestimmt. Das Phänomen der Wirklichkeit der Farbe als präsentisches Erleben, wie Josef Albers es beschrieb, ist eine wesentliche Bedingung für die Definition des Schönen als Struktur einer Kommunikation zwischen Individuum und Gegenstand. Die Rezeptionsformen der abstrakten Farbmalerei bieten dafür vielfältige Ansätze.  Durch den Begriff der Atmosphäre, den Gernot Böhme ausführlich dargestellt hat, kann das Schöne in den architektonischen Raum hineingelesen werden. |
|
|
schließen |